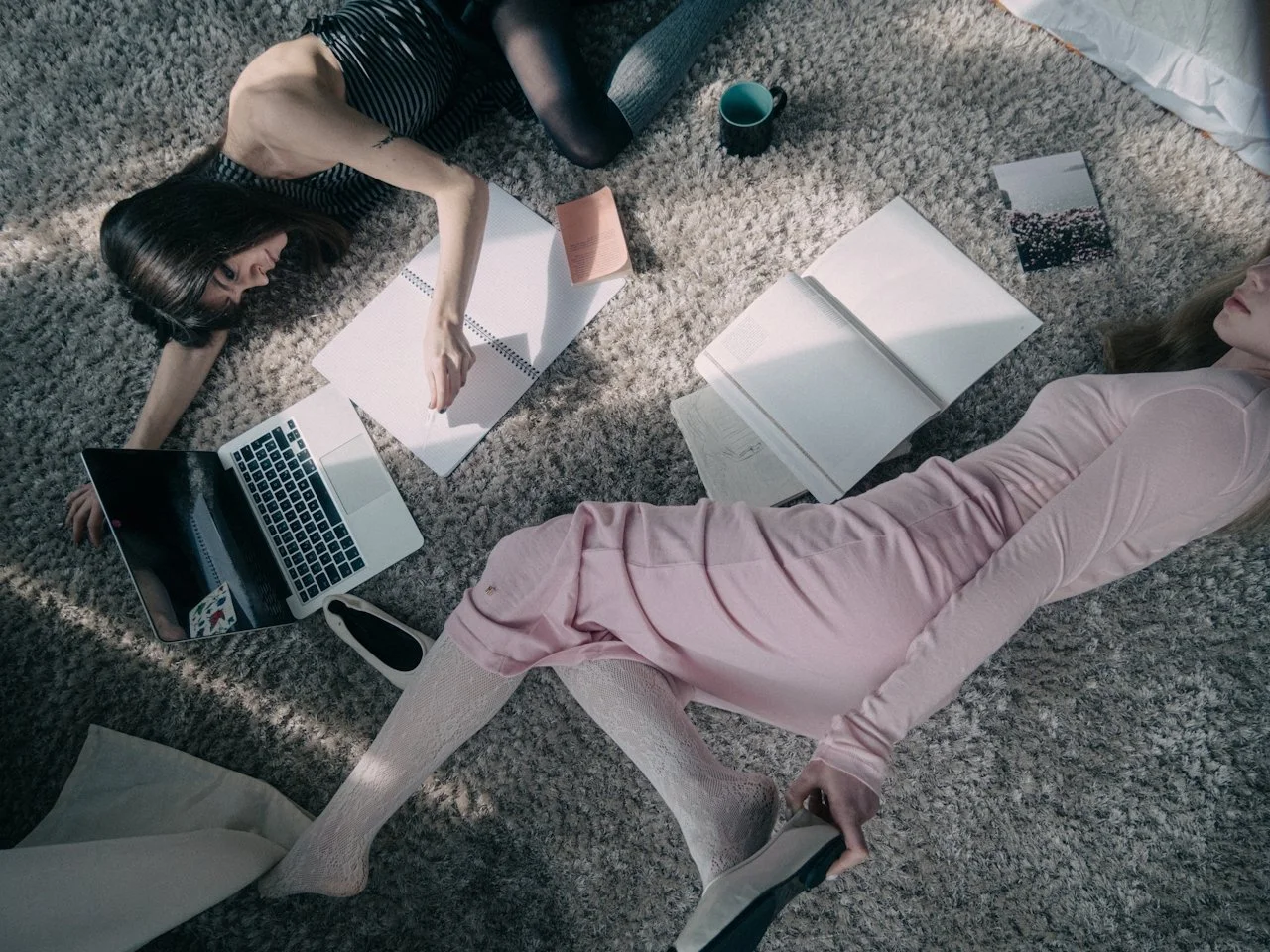Darf ich "Ich" schreiben in meiner Masterarbeit?
Wie du in wissenschaftlichen Texten, Masterarbeiten oder Diplomarbeiten mit dem Wort “Ich” umgehst.
Wer eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, begegnet früher oder später der Frage: "Darf ich überhaupt Ich schreiben?" Diese Unsicherheit ist vor allem im deutschsprachigen Raum weit verbreitet. In anderen Sprachräumen, etwa im Englischen, ist der Einsatz des "I" in wissenschaftlichen Texten viel üblicher. Und wenn mehrere Personen gemeinsam forschen, ist das "wir" ganz selbstverständlich. Die Antwort auf die Ich-Frage ist also differenzierter, als viele denken.
Wichtig ist: Das “Ich” macht einen Text nicht automatisch subjektiv.
Und umgekehrt: Wer das “Ich” zwanghaft vermeidet, schreibt nicht automatisch objektiv.
In diesem Artikel zeige ich dir, wo das Ich sinnvoll ist, wo du es vermeiden solltest und welche Alternativen dir zur Verfügung stehen. Denn dein Ich ist nicht nur sprachlich relevant, sondern auch Teil deines Denkens und Schreibens.
Wann das “Ich” erlaubt ist
In vielen Disziplinen ist das Ich ausdrücklich erlaubt oder sogar erwünscht, etwa:
in der Einleitung und Motivation, um deine Beweggründe zu erklären.
Zum Beispiel: "Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil..." oder "Mich interessiert besonders, wie...".
So machst du nachvollziehbar, warum du diesen Forschungsweg eingeschlagen hast.im Methodenteil, wenn du dein Vorgehen beschreibst.
Hier kannst du zum Beispiel schreiben: "Ich habe qualitative Interviews durchgeführt" oder "Ich habe die Daten mit Hilfe der Software XY ausgewertet".
Damit übernimmst du Verantwortung für deinen Forschungsprozess.im Ausblick, wenn du eigene Einschätzungen gibst.
Zum Beispiel: "Ich halte es für sinnvoll, in weiteren Studien..." oder "Aus meiner Sicht wäre eine vertiefende Analyse hilfreich...".
So zeigst du, dass du die Ergebnisse reflektierst und weiterdenkst.in der Danksagung sowieso.
Hier darfst du ganz persönlich werden: "Ich danke meiner Familie, die mich in dieser Zeit unterstützt hat" oder "Ein besonderer Dank gilt meiner Betreuerin, die mich mit konstruktivem Feedback begleitet hat".
In diesem Teil gehört dein Ich ganz selbstverständlich dazu.
Die Verwendung vom Wörtchen "ich" hängt auch stark von der Kultur innerhalb deiner Disziplin ab. Was in den Kulturwissenschaften selbstverständlich ist, kann in den Naturwissenschaften eher kritisch gesehen werden.
Deshalb mein Tipp: Sprich im Zweifel mit der Betreuungsperson deiner Arbeit. So schaffst du früh Klarheit über den gewünschten Stil und ersparst dir spätere Unsicherheiten.
Wann du das “Ich” besser vermeidest
Es gibt Abschnitte, in denen das “Ich” in deiner Masterarbeit oder Diplomarbeit eher fehl am Platz ist:
im Abstract
in Zusammenfassungen
Dort geht es um Kürze, um Objektivität, um eine distanzierte, überblicksartige Darstellung deiner Arbeit.
Darf ich “Ich” im Theorieteil verwenden?
Und wie sieht es mit dem Ich im Theorieteil aus? Auch hier ist Zurückhaltung meist angebracht, doch es gibt Spielräume. Du kannst zum Beispiel im Übergang zur eigenen Fragestellung schreiben: "Ich beziehe mich dabei auf das Modell von XY, weil..." oder "Die theoretische Rahmung erfolgt entlang der Konzepte von...". Das zeigt, dass du eine bewusste Wahl triffst. Eine andere Möglichkeit ist, das Ich nur einmalig zu Beginn zu setzen, um die Perspektive zu klären, und es danach nicht mehr zu wiederholen. Auch Formulierungen wie "Im Folgenden orientiert sich die Arbeit an..." oder "Diese Arbeit greift auf... zurück" funktionieren gut. Wichtig ist, dass deine Leser:innen nachvollziehen können, warum du welchen theoretischen Zugang wählst, ob mit oder ohne explizites Ich.
✍
Wie wissenschaftliche Texte formulieren,
ohne das Wort "Ich" zu verwenden?
Wenn du dein “Ich” aus stilistischen oder formellen Gründen vermeiden möchtest, gibt es mehrere Wege, dennoch aktiv und klar zu schreiben. Hier eine Übersicht der sechs gängigen Strategien mit meiner Empfehlung dazu.
Möglichkeiten zur Ich-Vermeidung:
Passivkonstruktionen (Empfehlung)
Unpersönliches Es (Empfehlung)
Unpersönliches Man (nur bedingt empfehlenswert)
Pluralis Majestatis (sehr veraltet)
Pädagogisches Wir (mit Vorsicht zu genießen)
Deagentivierung (Empfehlung!)
1. Passivkonstruktionen
Beispiel: "Im ersten Kapitel wird die Theorie erläutert."
Hier tritt das handelnde Subjekt zurück. Das kann sinnvoll sein, wirkt aber schnell unpersönlich oder schwer lesbar.
Mein Tipp: Verwende das Passiv sparsam und kombiniere es mit klareren Formulierungen.
2. Unpersönliches Es
Beispiel: "Es zeigt sich, dass..." oder "Es lässt sich erkennen..."
Das "Es" vermeidet eine direkte Zuschreibung. Es kann hilfreich sein, wenn Entwicklungen oder Ergebnisse dargestellt werden, ohne dass eine Person im Mittelpunkt steht.
Vorsicht vor übermäßiger Verwendung, sonst wirkt dein Text schnell vage.
3. Unpersönliches Man
Beispiel: "Wie man erkennen kann..." oder "Man sieht hier..."
Diese Form klingt allgemein und kann unklar sein. Wer genau ist "man"? Verwende diese Variante nur, wenn kein konkretes Subjekt gebraucht wird. Für viele Leser:innen wirkt sie distanziert oder ausweichend. Außerdem kommt “man” von “Mann”.
4. Pluralis Majestatis
Beispiel: "Wie wir gezeigt haben..."
Diese Formulierung stammt aus älteren wissenschaftlichen Traditionen. Sie wird heute kaum noch verwendet, es sei denn, du schreibst gemeinsam mit anderen. In Einzelarbeiten wirkt sie unpassend.
5. Pädagogisches Wir
Beispiel: "Wir beschäftigen uns nun mit..."
Diese Variante erzeugt ein Gefühl von Nähe zwischen dir und deinen Leser:innen. Das kann gewollt sein, aber auch aufgesetzt wirken. Für manche Leser:innen kann diese Formulierungsweise auch übergriffig wirken. (Ich mag das zum Beispiel gar nicht ;)) Besonders in wissenschaftlichen Texten empfiehlt es sich, diese Form nur gezielt einzusetzen.
6. Deagentivierung
Beispiel: "Die Analyse zeigt..." oder "Das Kapitel beschäftigt sich mit..."
Hier wird die Handlung einer Sache zugeschrieben: der Analyse, dem Kapitel, der Untersuchung. Das ist klar, dynamisch und gleichzeitig sachlich. Dies Formulierungsweise hat sich in der Wissenschaftswelt mittlerweile durchgesetzt (auch wenn grammatikalisch fragwürdig ;) in literarischen Texten empfehle ich diese Formulierung nicht).
—> In wissenschaftlichen Texten empfehle ich diese Strategie, wenn du dein “Ich” vermeiden willst.
Wähle jene Formulierung, die zu deinem Stil passt und deine Aussagen verständlich transportiert. Nicht jede vermeintlich objektive Form macht deinen Text besser. Ziel ist: Klarheit für deine Leser:innen.
Dein Ich im Schreibprozess
Gerade beim Rohtext-Schreiben empfehle ich dir, das Ich ruhig zuzulassen. Es ist oft einfacher, klarer und schneller, in der ersten Person zu formulieren, wenn du deine Gedanken entwickelst. Du kannst später immer noch entscheiden, ob du das “Ich” im Überarbeitungsprozess anpasst oder streichst. Das ist wirklich unkompliziert möglich. Auch wenn du das “Ich” im Text an manchen Stellen vermeidest: Du bist da. Du hast gedacht, gewählt, strukturiert. Ohne dein Ich keine Arbeit. Geh wertschätzend mit diesem Teil von dir um 💛 Auch wenn du ihn im Text überarbeitest oder unsichtbar machst, bleibt er grundlegend.
Zusammenfassung
Das Wort “Ich” ist in wissenschaftlichen Arbeiten kein Tabu. Es kommt darauf an, wo und wie du es einsetzt. Reflektiere deinen Stil, orientiere dich an die Kultur deiner Disziplin und nutze Alternativen sinnvoll.
Du brauchst Unterstützung?
In meinem Programm GuiDance begleite ich Studierende durch ihren Schreibprozess der Master- oder Diplomarbeit. GuiDance ist ein viermonatiger Online-Gruppen-Kurs. Mehr dazu hier.
Ein ganzer Kurs ist dir für den Anfang zu viel? Dann finde in deine Routine mithilfe der Friday Writedays (0€).
Oder du ziehst dich bei einem meiner Schreibretreats zur intensiven Arbeit zurück.
***
Schreib mir, wenn du Fragen hast oder mitmachen willst.
Dein Text wartet auf dich :)
Fotos: Death to Stock